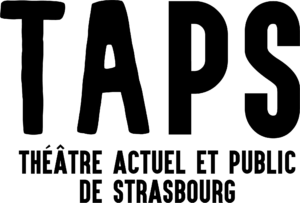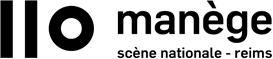Seit Beginn ihrer Kariere hat sich Hélène Grimaud bevorzugt mit den deutschen Klassikern befasst. Im Festspielhaus Baden-Baden bietet sie ein Konzert mit Werken der ‚drei großen Bs‘ der klassischen Musik: Bach, Beethoven und Brahms. Im Zentrum ihres Konzerts am Freitag, den 7. Juni 2024, um 20 Uhr, stehen Brahms’ letzte Klavierwerke. Neben dessen Drei Intermezzi und Sieben Fantasien“ spielt die französische Pianistin Beethovens Klaviersonate Nr 30, deren ergreifendes Finale als Variationen-Folge gestaltet ist sowie die Klavierversion von Bachs eigentlich für Violine geschriebener Chaconne. Die Bearbeitung stammt von einem Musiker, der das Trio der ‚großen Bs‘ zum Quartett ergänzt: Ferruccio Busoni.
Die in Aix-en-Provence geborene Hélène Grimaud wurde bereits im Alter von 13 Jahren am Pariser Konservatorium aufgenommen. 1987 gab die Pianistin ihr erfolgreiches erstes Solokonzert in Tokio und im selben Jahr lud sie Daniel Barenboim für ein Konzert mit dem Orchestre de Paris ein – der Beginn ihrer glanzvollen Karriere. Heute ist sie bekannt für ihre Konzerte mit den führenden Orchestern und Dirigenten der Welt und ihre Solokonzerte in allen bedeutenden Konzerthäusern und Festivals. Seit Hélène Grimaud im Alter von 18 Jahren die Konzertbühnen eroberte, ist der Weltklasse-Pianistin die Bewunderung eines großen Publikums sicher. Daneben ist sie Mitglied der Organisation „Musicians for Human Rights“ und engagiert sich als Naturschützerin und Buchautorin.
Das Konzertprogramm umfasst Werke von drei großen Meistern der deutschen Romantik und des Barock. Den Auftakt macht die Sonate Nr. 30 für Klavier op. 109 von Ludwig van Beethoven. Als Beethoven die Sonate komponierte, war er bereits vollständig ertaubt. Das Werk kann als Wunsch nach Versöhnung mit den inneren Kämpfen, als Wunsch, sich von den Traumata der Vergangenheit zu distanzieren, und als Bedürfnis, inneren Frieden zu finden, gedeutet werden. Es handelt sich um die erste der letzten Beethoven-Sonaten, mit denen er einen 1816 begonnenen Entwicklungsprozess abschließt, bei dem sich die formale Struktur von den klassischen Proportionsmodellen entfernt, während sein musikalisches Schaffen immer gewagter und überraschender wird.

Wiegenlieder des Schmerzes
Brahms nannte die Intermezzi „drei Wiegenlieder meiner Schmerzen.“ Sie zeugen von der Vereinsamung des alternden Komponisten, der hier auf Gedichte aus Herders „Stimmen der Völker“ zurückgriff. „Wiegenlied einer unglücklichen Mutter“ heißt das von Herder übersetzte schottische Volkslied, dessen Zeilen Brahms dem ersten Stück als Motto beigesellte: „Schlaf sanft, mein Kind, schlaf sanft und schön, mich dauert’s sehr, dich weinen sehn.“ Was sich dahinter verbirgt, ist die tragische Geschichte der Anne Bothwell, Was sich dahinter verbirgt, ist die tragische Geschichte der Anne Bothwell, der zweiten Frau Heinrichs VIII. von England, die der König hinrichten ließ. In der doppelten romantischen Metamorphose durch Herder und Brahms verwandelte sich „Lady Anne Bothwell’s Lament“ in ein Wiegenlied, das von wehmütigem Abschiedsschmerz durchzogen ist. Die Intermezzi gelten als Inbegriff des späten Klavierstils von Brahms – in ihrer Verknappung auf lakonische Gesten, in ihrer fast impressionistischen Klangaura und ihrem melancholischen Duktus.
Gewidmet ist das Werk Clara Schumann. Sie bemerkte dazu: „Die Stücke sind, was Fingerfertigkeit betrifft, nicht schwer, aber die geistige Technik darin verlangt ein feines Verständnis, und man muß ganz vertraut mit Brahms sein, um sie so wiederzugeben, wie er es sich gedacht.“
Memento mori
Monologe eines Einsamen sind es, die „Sieben Fantasien“. Der mondäne Rahmen für diese Monologe eines Einsamen war das Kaiserbad Ischl im Salzkammergut. Gewidmet sind auch sie höchstwahrscheinlich der geliebten Clara Schumann. Sie zeichnen sich durch ihren introspektiven Charakter, ihre intensive Lyrik und den ständigen Wechsel von aufgewühlten Momenten und kurzen Momenten der Ruhe aus. In diesen Stücken experimentiert Brahms mit großem Einfallsreichtum mit Rhythmus und Harmonie. Zusammengenommen sind sie eine Reflexion über Leben und Tod, ein Nachdenken über die menschliche Sterblichkeit und die Hoffnung auf eine göttliche Erlösung.
Musikalisches Gedenken
Das abschließende Werk ist die Transkription für Klavier des italienischen Komponisten Ferruccio Busoni der Chaconne aus der Partita Nr. 2 für Violine von Johann Sebastian Bach. Bach komponierte die Chaconne während seines Aufenthalts in Köthen, als er für den Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen arbeitete. Man nimmt an, dass Bach sie unmittelbar nach dem Tod seiner Ehefrau Maria Barbara Bach, komponierte, da sie in ihrem Charakter den Klageliedern Monteverdis nahe steht. Die Musikwissenschaftlerin Helga Thoene hat zudem in der Chaconne mehrere Melodien von Bachs Chorälen versteckt sind, die um das Thema Tod und Auferstehung kreisen. So etwa die Melodie „Den Tod niemand zwingen kunnt“ oder der Choral „Vom Himmel hoch da komm ich her“, der die Hoffnung symbolisiert.
Formal besteht die Chaconne aus freien Variationen über einem Thema in der Bassstimme, das ununterbrochen wiederholt wird. Ein ständig um sich selbst kreisender Gedanke, den Bach ganze 32 Mal eindringlich variiert.
Ob der Form oder des Inhalts wegen – Johannes Brahms war schlicht begeistert: „Die Chaconne ist mir eines der wunderbarsten, unbegreiflichsten Musikstücke. Auf ein System für ein kleines Instrument schreibt der Mann eine ganze Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen. Hätte ich das Stück machen, empfangen können, ich weiß sicher, die übergroße Aufregung und Erschütterung hätten mich verrückt gemacht.“