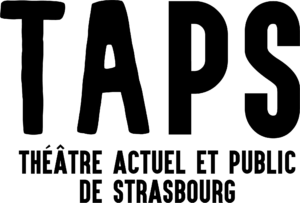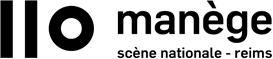Der zweite Teil der Musikfestspiele Saar startet am 10. September 2021 wieder mit Live-Konzerten. szenik hat sich vorab mit Bernhard Leonardy (Intendant und Künstlerischer Geschäftsführer) und Eva Karolina Behr (Dramaturgie / Künstlerische Projektleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) über diese besondere Ausgabe und grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterhalten.
Der zweite Teil der Musikfestspiele Saar steht unter der Suche nach dem Ursprung. Dies klingt sehr nach Goethes Faust. Wollen Sie musikalisch herausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält?
Bernhard Leonard Ohne Kultur, insbesondere Musik, driftet die Gesellschaft auseinander, wir haben es in der kulturlosen Zeit leibhaftig erlebt. Unser Festival ist ein sicherlich nicht allzu unwichtiger Beitrag zum Zusammenhalt der Menschen, ein Neustart, der Perspektiven, Lichtblicke und neue Impulse aussendet. Vieles, von Europa bis hin zu Mitmenschlichem, gilt es wiederzubeleben.

Auf der Homepage steht die Frage geschrieben: Wie kann Neues aus Altem entstehen? Nun ist unsere Frage: Wie kann Musik in einer Zeit / Periode entstehen, die mit Unbekanntheit, Einsamkeit, Krankheit und Angst verbunden ist? Nehmen MusikerInnen oder KünstlerInnen in einer solchen Zeit eine Rolle der Hoffnung oder einer schöpferischen Zukunft ein?
Eva Karolina Behr Seit Jahrhunderten war die Kunst im Allgemeinen, aber auch die Musik im Speziellen immer Katalisator für neue Entwicklungen. Lange bevor es dann tatsächlich zu politischen oder gesellschaftlichen Umwälzungen kam, haben Künstler die Zeichen der Zeit gesehen und diese in Ihren Werken widergespiegelt – doch dies nie, ohne die Tradition zu verleugnen. Und das ist auch das Motto der Musikfestspiele: unser Anliegen ist es, neues Publikum zu gewinnen, junge, interdisziplinäre Programme zu entwickeln, neue interpretationen zu präsentieren, und trotzdem an dem traditionellen klassischen Kanon festzuhalten.
Mit Picknick-Konzerten, einem Kinderprogramm und Veranstaltungen an außergewöhnlichen Orten scheinen Offenheit und Zugänglichkeit Schlüsselwörter der Musikfestspiele zu sein. Welchen Raum nimmt diese Reflexion in der Vorbereitung und Durchführung des Festivals ein?
B.L. Ein Festival wie das unsrige hat die ureigenste Aufgabe ständig auf der Suche nach Neueinsteigern der Klassischen Musik zu sein. Wir dürfen uns nicht in Abonnementsphilharmonien verschanzen, sondern dort hingehen, wo man vermeintlich Elitäres nie zu finden glaubt.

Die Förderung von NachwuchskünstlerInnen scheint ebenso ein felsenfester Bestandteil der Musikfestspiele Saar zu sein. Mit welchen Motivationen und Zielen gehen Sie daran? Ist dies eine Arbeit, die auch über den Zeitraum des Festivals hinausgeht?
E.B. Ja, wir beide sind immer bemüht, junge Musiker kennenzulernen, neue Konzepte und Projektideen zu entwerfen, offen zu sein für das, was sich in der jungen klassichen Szene gerade entwickelt. Und da war es uns in der Coronazeit, wo gerade diese jungen Musiker, die noch kein festes Engagement hatten und in ihrer musikalischen Entwicklung ausgebremst wurden, ein wenig unter die Arme zu greifen.
2020 haben wir zusammen mit unserem Kooperationspartner „Wirtschaftsclub Saar-Pfalz-Moselle – Saarbrücker Casino Gesellschaft“ die Musikersoforthilfe Saar gegründet, ein Fonds für finanziell benachteiligte Künstler im Saarland. Der Zuspruch war überwältigend und wir konnten viele jungen MusikerInnen unterstützen.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Konzert erinnern? Die Klassik und Sie: War es Liebe auf den ersten Blick?
B.L. Zuerst kam bei uns in einem „Künstlerhaushalt“ (die Mutter Malerin, der Vater Pianist) das eigene Musizieren, Konzerte hören kam viel später. Anfangs war ich wenig begeistert von eher sportlichen Übungen ohne Ball nur auf den Tasten, Musik lieben gelernt habe ich erst als völlig unausgebildeter „Chorleiter“ in sehr frühen Jahren, wobei mir meine Mutter kurz vor der ersten Probe die Zeichengebung des 3er und 4er Taktes hinterherrief. Meine Musikbegeisterung kommt daher eher vom Vokalen, ich bin direkt in die Messen von Bruckner hineingesprungen.

Das Programm und die Titel der Konzerte lesen sich wie ein poetischer Traum. Renommierte KünstlerInnen treffen hier auf neue, Genres zusammenführende Produktionen. Wie hält man aber die Balance zwischen Uraufführungen / Auftragswerken und den sogenannten „Kassenschlagern“?
E.B. Wichtig dabei ist der berühmte rote Faden, den ich als Dramaturgin immer im Blick behalten muss. Jede Festivalsaison steht ja unter einem bestimmten Motto, in diesem Jahr ist das „Ursprünge“, ein Dialog zwischen Natur und Industrie – zwischen Rückschau und Zukunft. Dabei spielen wir Naturprogramme in Industriehallen, gehen aber auch raus in die Natur und bespielen Gärten und Parks. So kommt es, dass es in einer Saison einen Bänkelsänger mit Laute im Garten der Sinne zu hören, die 5. Sinfonie von Schubert, aber auch eine ganz neu entstandenes Werk Neuer Musik.
Sie locken mit der Uraufführung der „Flegeljahre“ von Stefan Litwin. Wie kam diese Kooperation zustande?
E.B. Die Idee zum Werk liegt schon fünf Jahre zurück. Damals hat sich der Komponist Stefan Litwin mit dem Librettisten Holger Schröder getroffen und ihn gefragt, ob der denn Jean Paul kenne, diesen Meister der Naturbeschreibung im 19. Jahrhundert. Er plane ein Stück über dessen Roman „Flegeljahre“, in dem Zwillinge die Hauptprotagonisten sind. Er würde gerne ein Stück komponieren für das Piano Duo Grau Schumacher (weil es eben um Zwillinge geht) und Ulrich Noethen solle als Schauspieler in alle Rollen schlüpfen. Holger Schröder sollte aus dem 500 Seiten starken Roman eine Bühnenfassung schreiben. Dieses Treffen war der Ursprung dieses großartigen Projekts.
Ich hatte mit Stefan Litwin schon als Dramaturgin bei seinem Musiktheater „Nacht mit Gästen“ zusammengearbeitet und als ich dann in die Festivalleitung der Musikfestspiele berufen wurde, wollte ich dieses Projekt unbedingt ins Programm aufnehmen. Und so ist das Projekt seit vielen Jahren gewachsen, auch die Künstler, GrauSchumacher und Noethen, waren von Anfang an Ideengeber.

Die Musikfestspiele Saar sehen sich als ein grenzüberschreitendes Festival, als Festival „im Herzen Europas“. Hat Musik auch den Ruf Grenzen leicht zu überschreiten, scheinen Kooperationen (trotz der Nähe) zwischen Orchestern / Ensembles und Bühnen oft schwierig. Woran liegt dies Ihrer Meinung nach und was muss noch getan werden, um einen besseren oder einfacheren KünstlerInnen-Austausch in dieser Großregion zu ermöglichen?
B.L. Hier muss die Politik ran. Es kann nicht sein, Ausländersteuer für Kulturaustausch einzufordern. Wieso gibt es keine Struktur für grenzüberschreitende gemeinnützige Initiativen? Auch bei gegenseitigen politischen Besuchen bleibt die Kulturbeteuerung merkwürdig theoretisch, es folgen keine Taten. Daß es dennoch funktioniert hängt mit persönlichen Freundschaften zusammen, die sich dann trotz völlig unterschiedlicher Strukturen dagegenstemmen und Nachhaltiges auf die Beine stellen. Bei einem oft eher wackelig-einbeinigen Europa eine Tat der reinen Vernunft.
Die Musikfestspiele Saar blicken auf 32 Jahre zurück. Für ein Festival ist dies eine beachtliche Zeit! Gibt es dennoch Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen (wenn Sie zum Beispiel an die kommenden Jahre der Musikfestspiele denken)?
B.L. Die entscheidende Frage: Kann man ein Festival unverzichtbar verankern für eine Zukunft nach uns, vor dem Hintergrund unserer Überzeugung, daß unser Auftrag von Hochkultur, Bildung, Berühren der Seele, Schaffen eines klaren Geistes (und vieles mehr) ein Wesentlicher ist, der menschliches Zusammenleben ermöglicht.
Der so aktuelle Wunsch nach einem Weniger an Verboten, Vorschriften, Bevormundungen usw. wird nur durch ein Mehr an Kulturkontinuität eines Programms höchster Qualität gelingen. Können wir durch unsere Arbeit die Menschen über Wahlperioden hinaus davon überzeugen?

In ein paar Tagen beginnt nun der zweite Teil der Musikfestspiele Saar. Gibt es Momente, denen Sie ganz besonders entgegenfiebern?
E.B. Jedes Konzert birgt für sich etwas Einzigartiges. Aber jedes Mal ist der Moment für mich am Berührendsten, wenn der sich der ganze Vorbereitungs- und Einlasstrubel legt, das Licht ausgeht und der erste Ton erklingt. Das weiß man, dass sich als die Mühe der letzten Monate gelohnt hat.
B.L. Letztlich ist es das besondere Festivalfieber, welches einen 4 Wochen lang nicht mehr loslässt. Danach ist man sicherlich körperlich erschöpft, aber geistig wie neugeboren. Ich möchte enden und gleichzeitig beginnen mit Mikis Theadorakis:
„Unser Reichtum liegt nicht auf einem Bankkonto, unser Reichtum sind Bildung und Kultur!“
Interview: j. lippmann
Am 3.09.2021
Foto: Bundesjazzorchester 2020_2021_2022 © Christian Debus