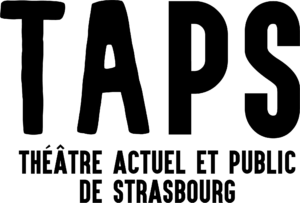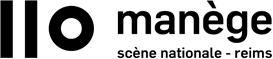Wie haben Sie die Saison des Philharmonischen Orchesters Freiburg aufgebaut? Was sind ihre Höhepunkte? Welche Gleichgewichte sind für Sie wichtig?
In der Saison 2023/24 steht die Sinfonie im Fokus: Wir wollen zeigen, was eine Sinfonie, die Königsdisziplin der klassischen Musik, alles sein kann, auch im Wandel der Jahrhunderte – angefangen von Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll, über Gustav Mahlers 5. Sinfonie bis hin zu einer sehr ungewöhnlichen Sinfonie des amerikanischen Minimal-Komponisten Julius Eastman, dessen 2. Sinfonie wir in unserem letzten Konzert präsentieren werden.
Und dann schaue ich natürlich auch immer gerne, was es für interessante Strömungen in der neuen Musik gibt, was es stilistisch für neue Komponistinnen und Komponisten gibt. 2023/24 präsentieren wir zum Beispiel mit Ellen Reid und Nicole Lizée wieder zwei sehr interessante Komponistinnen, die in Deutschland noch nicht so oft zu hören gewesen sind, in Amerika und auch in Europa aber schon ziemlich große Wellen schlagen. Also Entdeckungen sind auf jeden Fall auch immer Teil unseres Programmes.
Wie beschreiben Sie Ihre Beziehung zu Ihren Musikern?
Die Saison 2022/23 war meine erste als Generalmusikdirektor am Theater Freiburg und dementsprechend zunächst sehr stark vom Kennenlernen mit den Musikerinnen und Musikern des Philharmonischen Orchesters geprägt. Das ist ein sehr spannender und natürlich vor allem ein großer vertrauensbildender Prozess. Ich glaube, für die Musikerinnen und Musiker mir gegenüber noch mehr, als für mich. Ich musste natürlich auch erst mal ihr Vertrauen gewinnen. Dieser Prozess ist insofern sehr wichtig, als ich überzeugt davon bin, dass aus gegenseitigem Vertrauen bessere Kommunikation und auf diese Weise bessere Musik entsteht.
Das Autoritäre sogenannter „Maestro Figur“ aus früheren Zeiten hat glücklicherweise mehr und mehr ausgedient. Mir sind gegenseitiger Respekt und eine gewisse Wärme extrem wichtig, sowohl auf musikalischer als auch auf menschlicher Ebene. Das ist die Basis für mein Verhältnis zu den Musiker_innen, und so verstehe ich auch unsere Art des Umgangs miteinander. Ich habe das Orchester sowohl musikalisch als auch menschlich sehr zu schätzen gelernt, und das bedingt sich für mich absolut gegenseitig.

Im Bereich der Oper: Wie haben Sie die neuen Opernproduktionen ausgewählt?
Sie eröffnen die Opernsaison mit Hänsel und Gretel: Warum haben Sie diese Wahl getroffen? Was sagt uns diese Oper heute?
Tatsächlich habe ich in der Saison 2022/23 entweder moderne, zeitgenössische Musik gemacht oder eben Barock, also sehr spezielle Felder der stilistisch weit gefächerten Bandbreite auch fürs Orchester. In der nächsten Saison wollte ich nun mehr Klassiker machen, da wo das Orchester eigentlich stärker zuhause ist.
Auch ein romantischeres Repertoire sollte es geben – hier ist die Wahl nun auf HÄNSEL UND GRETEL gefallen, was für mich musikalisch eine der tollsten Opern überhaupt ist. Auch für das Orchester ist es eine große Freude, das zu spielen und damit die Saison zu eröffnen. HÄNSEL UND GRETEL ist gleichzeitig natürlich auch ein ungeheuer populäres Stück, ein echter Klassiker. Interessant finde ich, dass es auf mehreren Ebenen funktionieren kann, also nicht nur als Märchen für Kinder, sondern eben auch, wie alle guten Märchen, für die ganze Familie. Es ist Oper für alle.
Neben HÄNSEL UND GRETEL übernehme ich in der nächsten Saison die musikalische Leitung für die Opern DON CARLOS und DIE ZAUBERFLÖTE. Wenn man so will, ist das ein bisschen das Kontrastprogramm zur letzten Saison. Diesmal nehme ich mir die großen Klassiker vor. Wobei ich bei allen drei Produktionen die Regisseur_innen und ihre Herangehensweise gut kenne – ich denke, dass das eine spanende Zusammenarbeit werden wird.
DIE ZAUBERFLÖTE ist bei uns im Übrigen auch nicht die klassische „Zauberflöte“, sondern sie trägt noch einen Zusatz: Der Titel lautet „GAME ON: DIE ZAUBERFLÖTE“. Es ist genau genommen ein Musiktheaterstück nach der Zauberflöte, eine digitale Interpretation, die von Rollenspielen im Computer-Gaming-Bereich sehr stark beeinflusst ist. Die Zauberflöte als Rollencomputerspiel, sozusagen. Das Digitale und Analoge werden sich bei dieser Produktion im Bühnenraum verbinden. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Experiment.
Ihr Programm ist sehr offen, insbesondere mit dem Freiburg.Phil Club: Wie sieht diese Initiative aus?
Der FREIBURG.PHIL CLUB ist eine Konzertreihe, die wir in der Saison 2022/23 in Kooperation mit verschiedenen Musikveranstaltern und Clubs in Freiburg ins Leben gerufen haben. So finden auch die Veranstaltungen selbst sowohl bei uns im Theater, als auch in den Clubs, also im Slow Club und Jazzhaus Freiburg, statt. Die Idee ist, dass unser Philharmonisches Orchester als „Vorband“ von musikalischen Gästen aus den Bereichen Pop, Elektronik, Jazz und Independent fungiert, die wir eingeladen haben. Im Anschluss spielt diese Band noch ihr eigenes Set, und es wird in der Regel auch ein Stück gemeinsam gespielt.
Es ist also immer ein dreiteiliger Abend, den ich moderiere und bei dem ich versuche, Verbindungen herzustellen, eine Mischung aus Late Night Talkshow und Club Gig zu schaffen – nur eben mit integriertem klassischem Orchester. Die Reihe ist in ihrer ersten Spielzeit sehr gut angekommen und aufgenommen worden, sodass wir sie in 2023/24 fortsetzen werden.
Was ist Ihr Lieblingsprogramm in der Saison?
Vielleicht würde ich hier tatsächlich Philip Glass‘ Sinfonie Nr. 4 HEROES zusammen mit Beethovens Violinkonzert nennen. In der kommenden Saison wird es zwei Konzerte geben, die unter dem Programmtitel „Helden“ laufen, bei denen es also in der Musik um Helden oder auch Antihelden geht. Auf der einen Seite steht das Heroische in Beethovens Musik, das in seinem Violinkonzert umgekehrt wird ins sehr Subtile, sehr Persönliche. Und dann eben Philip Glass, der sich in seiner Sinfonie zum Thema genommen hat, David Bowies Album HEROES sinfonisch zu verarbeiten. Dabei hat er eigentlich über jeden Song einen Satz geschrieben, sich ein Motiv herausgenommen und das verarbeitet. Er bezieht sich sozusagen auf David Bowies Darstellung von Helden und das sehr eigenwillige Verständnis von Helden. Dieses Verständnis hat sich im Laufe der Zeit stark gewandelt, in Beethovens Zeit zum Beispiel in Hinblick auf Napoleon: Beethoven war zunächst ein Fan von Napoleon, aber als er gesehen hat, was Napoleon wirklich gemacht hat, wendete er sich von ihm ab. Napoleon wurde also zum Antihelden für Beethoven, was sich in der EROICA musikalisch niedergeschlagen hat.
Für mich ist das eine wunderbare Kombination.