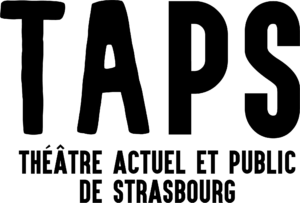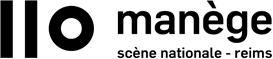2019 gewann der vielfach ausgezeichnete Videokünstler Max Philipp Schmid den Basler Medienkunstpreis. Seine Arbeiten, die sich hauptsächlich mit sozialen Fragen auseinandersetzen, finden weltweit Anerkennung. Nun hat sich #szenikmag mit dem Medienkünstler über seine Begeisterung zum Medium Film und den Reiz des digitalen Vergessens unterhalten.
Am 17. Januar wird Ihr Kurzfilm „Membran“ im Rahmen des Art’s Birthday im E-Werk Freiburg gezeigt. Worum geht es in dieser Arbeit?
In Membran geht es um Filterung. Unsere Gesellschaft ist einer großen Informationsflut ausgesetzt. Wir erhalten auf den verschiedensten Ebenen sehr viele Informationen, die gefiltert werden müssen.
Betrachten wir eine Membran von einem biologischen Standpunkt aus: Die Zellhaut entscheidet, was hineinkommt und was hinausgeht. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil die Membran sich nicht einfach schließen kann. Denn eine Zelle, deren Membran nichts hineinlässt, stirbt. Das finde ich eine interessante Metapher für unseren Zustand der Informationsverarbeitung.
Ich habe zu Beginn ein Setting mit drei Protagonist*innen entworfen und stark an Texten gearbeitet, die sich mit dieser Problematik auseinandersetzen. Zum Beispiel: „Wie positioniere ich mich in der Gesellschaft?“, „Mit welchen Fragen werde ich konfrontiert?“, etc. Diese Textbausteine erscheinen in der Arbeit als Textcollage und sind den Figuren zugeordnet.

Wie werden die Texte in der Regel ausgewählt?
Die Texte suche ich zusammen. Hauptsächlich sind es Texte, auf die ich während der Recherche stoße oder die mich interessieren. Meine Produzentin Stella Händler hat aber bei Membran daran mitgearbeitet. So sammeln wir sehr viele Texte und wählen diese zum Schluss aus – es ist so eine Art Destillierprozess.
Wie ist Ihre Vorgehensweise?
Gibt es eine Grundidee, auf der Sie aufbauen?
Es gibt eigentlich keinen Ausgangspunkt. Es gibt auch nicht die Idee. Allerdings gibt es verschiedene Auseinandersetzungen, wie inhaltliche Fragen, die mir im Leben begegnen, die mich beschäftigen. Ich bin Teil der Gesellschaft und insofern auch in Anspruch genommen. Zudem gibt es formale und ästhetische Fragen, die mich interessieren. Diese materialisieren sich irgendwann peu à peu (zeigt auf eine Wand, an der zahlreiche Bilder befestigt sind), bis ich an einen Punkt komme, an dem ich zwischen einzelnen Aspekten eine Verbindung spüre… Wenn ich merke, wie zum Beispiel zwischen einem inhaltlichen und formalen Aspekt eine Brücke entsteht, dann macht mich das neugierig, denn es sagt zugleich etwas über mich als Person aus.

Gibt es Themen, die Sie besonders interessieren und die immer wieder in Ihren Arbeiten auftauchen?
Ich bevorzuge den Begriff der „thematischen Felder“. Meistens sind es Fragen, wie zum Beispiel „Wie sieht unsere Gesellschaft aus?“, „Wie leben wir?“, „Was haben wir für Befindlichkeiten, für Fragen, für Probleme, für Widersprüche?“, die mich beschäftigen. Ich wende dabei eher eine soziologische als eine psychologische Vorgehensweise an, da für mich Fragen der Gesellschaftlichkeit und der sozialen Wesen vordergründig sind.
Wie kamen Sie zur Medienkunst? Gab es dafür einen Auslöser?
Begeisterung! Ich war einfach filmbegeistert, obwohl ich kein Filmemacher oder Geschichtenerzähler werden wollte. Die filmische Bildwelt hat mich eher gereizt. Aber es war ein torkelnder Einstieg: Ich war zuerst Bühnenbildner am Theater und dann habe ich mir nach und nach viel autodidaktisch angeeignet. Heute machen die Medienkünstler eher ein Masterstudium.

Kann das Medium Video etwas erzählen, was die Bühne nicht erzählen kann?
Ich glaube nicht, dass es Dinge gibt, die nur filmisch oder nur theatral erzählt werden können. Wenn ich etwas erzählen möchte, dann muss ich sehr stark von meinem ausgewählten Medium ausgehen. Was mich beim Film oder Medialen sehr anzieht ist die Geschichte dahinter. Film ist eine ganz eigene Sprache, die natürlich aus dem Roman und dem Theater kommt und eine Dramaturgie hat. Aber auf dieser Filmsprache kann man aufbauen. Ich finde das sehr interessant, weil Film in einer Art und Weise eine populäre Kultur ist. Das heißt, jeder der sich theoretisch nicht für Film interessiert, versteht trotzdem viel davon, weil er schon sehr viele Filme gesehen hat. Das ist eine spezielle Qualität, die mich sehr interessiert, obwohl ich sicherlich keine Arbeiten mache, die wahnsinnig populär sind.
Wie hat sich Medienkunst in den letzten Jahren entwickelt?
Ist es schwierig als Medienkünstler Fuß zu fassen?
Ich finde es heutzutage schwierig in diesen Bereich einzusteigen, denn es gibt von allem schon sehr viel. Es gibt sicherlich zahlreiche Studiengänge, aber da sitzen heute viele Student*innen drin. Für mich war das dann doch noch anders, denn es gab ein viel kleineres Feld von Leuten, die sich mit Videokunst auseinandergesetzt haben.
Um ehrlich zu sein habe ich keine Ahnung, wie ich es damals angestellt habe: Ich habe einfach gearbeitet. Ich konnte mir diese Begeisterung erhalten, aber dafür brauchte es auch andere Leute, die mir geholfen haben. Es ist ungemein wichtig sich mit anderen zusammen zu tun und nicht zu versuchen alles alleine zu bewältigen. In der Zusammenarbeit mit anderen Personen entsteht eine Dynamik und die hilft… und irgendwann sind dann 20, 30 Jahre vorbei und man sieht, dass es geklappt hat.

Videoinstallationen tauchen immer öfter in Ausstellungen auf. Braucht es aber eine besondere Vermittlungsarbeit, um das Publikum auf Medienkunst vorzubereiten?
Das ist eine heikle Frage, weil ich ein großes Vertrauen an die Zuschauer*innen habe. Ich glaube, sie können eine Arbeit genauso wie ich verstehen, wenn sie das wollen… und wenn sie es nicht wollen, dann ist das ihr gutes Recht. Meine Arbeiten sind Angebote und diese kann man wahrnehmen oder nicht. Man sollte nicht gezwungen sein, sich solche Werke anzusehen. So ein Kunstkanon ist mir immer etwas unheimlich.
Ich finde, Kulturjournalismus oder das Projekt des Art’s Birthday des Freiburger E-Werks natürlich gut, denn es geht hierbei um den Versuch ein Publikum zu finden und Kunst näher zu bringen. Gerade im Kulturjournalismus ist in den letzten Jahren einiges weggebrochen und das ist sehr schade. Da fehlt immer mehr die Auseinandersetzung mit den Werken und bleibt oberflächlich gesprochen bei „Hier stellt der/die berühmte Künstler*in aus.“.
Wie hat sich Ihre Videokunst entwickelt?
Sind Sie mit den Jahren mutiger geworden und haben sich an anderen Bereichen, wie zum Beispiel Sounddesign, versucht?
Ich versuche mutiger zu werden (lacht). Am Ton habe ich aber immer gearbeitet, denn das mache ich sehr gern. Aber natürlich hole ich mir immer kompetente Personen dazu, schließlich ist mein Hauptgebiet das Bild und in den anderen Bereichen gibt es einiges, das ich nicht kann. Auch beim Bild arbeite ich immer mit einer Kamerafrau oder einem Kameramann zusammen, denn auch das können andere besser.
Ich habe gemerkt, dass es mir schwer fällt, eine Arbeit quasi aus dem Fundus zu machen. Also eine Arbeit nach dem Prinzip einer bereits entstandenen Projekts zu kreieren, klappt nicht. Es braucht einfach etwas, dass mich herausfordert und dann kommt auch irgendetwas in Gang. Wenn die letzte Arbeit zur Konkurrenz eines neuen Werkes wird, dann gibt es irgendwann eine Blockade.

Wie sehr beschäftigen Sie sich mit der Frage der technischen Erhaltbarkeit von Medienkunst?
Diese Frage beschäftigt mich sehr. Allerdings habe ich das Glück, das zum Beispiel Membran von der Sammlung dotmov.bl – die Sammlung Neue Medien Baselland gekauft wurde. Das ist ein sehr tolles Projekt, denn dotmov.bl kümmert sich auch um die Archivierung solcher Arbeiten, denn das Archivieren neuer Medien ist sehr komplex und aufwendig. Ein Ölgemälde ist weitaus haltbarer als ein digitales Produkt. So bin ich bei jeder Arbeit froh, wenn sie von einer Sammlung übernommen wird (lacht).
Andererseits finde ich es gar nicht so schlecht, wenn Dinge auch irgendwann verschwinden. Ich habe nicht das Gefühl, dass man alle meine Arbeiten in 500 Jahren noch anschauen muss. Es ist auch beängstigend, wenn alles archiviert wird. Ich finde, das digitale Vergessen gilt auch ein bisschen für die Kunst.
Art’s Birthday
Ein Projekt des E-Werk Freiburg in Kooperation mit dem SWR.
Vom 17. Januar bis 31. März 2021 online verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
– Zum Facebook-Event –

Max Philipp Schmid
Geboren 1962 in Basel, Schweiz. 1981-82 Studium der Kunstgeschichte an der Universität Basel. 1983-88 SfG (Schule für Gestaltung) Basel. 1988 Diplom Lehramt für Bildende Kunst SfG Basel. Seit 2002 Lehrauftrag «Bewegtes Bild» an der SfG. Gastdozent an den Hochschulen Bern, Zürich, Basel. Seit 2009 Gastdozent an der HSLU (Hochschule Luzern, Design & Kunst), Studienbereich Video. Freischaffender Regisseur und Videokünstler. (Biografie: www.swissfilms.ch)
Das Interview führte J. Lippmann I 12.01.2021
Foto: Wille & Glück (Der König), 2004